Im Gespräch mit Dr. Marko Kovic und Dr. Nikil Mukerji über die Skeptiker/innen-Bewegung und wie wir miteinander und mit anderen umgehen sollten.
Podcast: Play in new window | Download
In unserem Podcast geht es um Wissenschaft, und wie sie Wissen schafft.
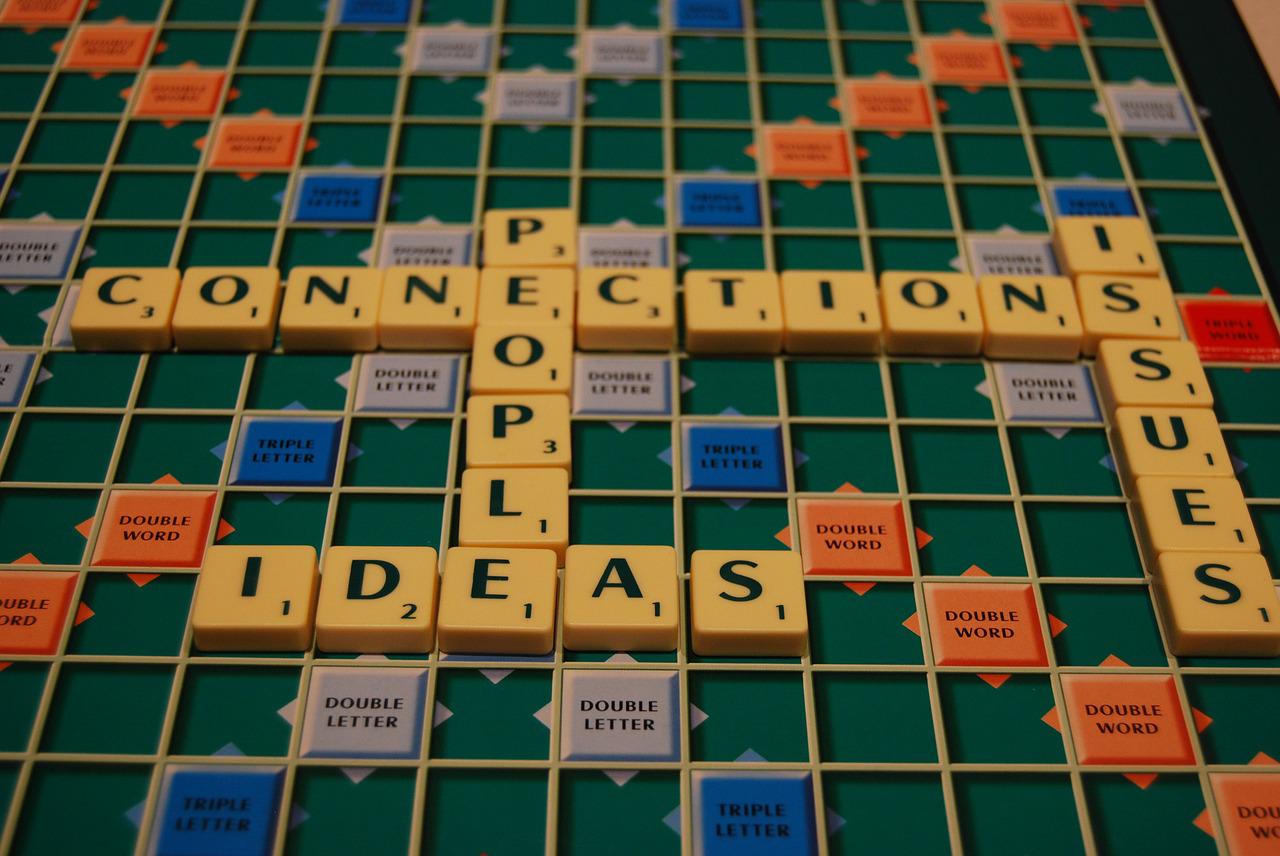
Im Gespräch mit Dr. Marko Kovic und Dr. Nikil Mukerji über die Skeptiker/innen-Bewegung und wie wir miteinander und mit anderen umgehen sollten.
Podcast: Play in new window | Download
[…] Podcast: „Kritisches Denken“ mit Dr. Marko Kovic und Dr. Nikil Mukerji […]
[…] Podcast: „Kritisches Denken“ mit Dr. Marko Kovic und Dr. Nikil Mukerji vom 11. Mai 2022 […]
Ich habe Euren Podcast gerade erst entdeckt. Sorry für den späten Kommentar.
Als Skeptiker*in würde ich zunächst mal klarer trennen zwischen Evidenz (reproduzierbaren oder zumindest nachvollziehbar gemessenen Daten) und Simulationen, die hier im Gespräch wie auch anderswo als Ersatz für Evidenz gehandelt werden – eigentlich ein NoGo für Skeptizismus.
Ioannidis und andere Skeptiker haben das getan und die verfügbaren Daten nach bisher üblichen Kriterien überprüft. Ihnen das vorzuwerfen und das Bestreben, deduzierte Aussagen mittels manipulativer Techniken (Framing, vorbereitete Argumentationsketten etc.) als wissenschaftliche Wahrheit zu kommunizieren, halte ich für das Gegenteil einer erkenntnisoffenen (skeptischen) Geisteshaltung, die sich eigentlich darum scheren sollte, das Gegenüber von irgendeinem Standpunkt zu überzeugen, ausser vom Zweifel selbst, erst recht nicht Ängsten und mögen sie noch so existenziell sein.
Simulationen sind grundsätzlich eine megaspannende Sache. Die simulierten Szenarien beruhten jedoch auf teilweise fragwürdigsten Annahmen (Stichwort statischer R-Wert, Testspezifität, Massnahmeneffektivität), die von Wissenschaftlern geradezu zwingend in Zweifel gezogen werden müssen, umsomehr wenn man sich auf den Skeptizismus beruft.
Den Umgang mit den Ergebnissen solcher Simulationen halte ich deshalb für sehr altertümlich. „Experten“ rufen zu Einigkeit und Opferbereitschaft, damit die Götter (früher gross, heute klitzeklein) nicht zürnen. Und die „Nicht-Experten“ reagieren gewohnt abergläubisch „Wenn ich jetzt kein Opfer bringe, dann bleibt der Mond dieses Mal an der Sonne hängen und meine Ernte geht ein. Wenn mein Opfer aber richtig weh tut, dann scheint die Sonne auch künftig auf meinem Acker noch mehr.“
Dieses Verhalten ist wohl, wie auch im Altertum, politisch gar nicht mal so ungewollt und kann (und wird) von gewissen Playern zur Erreichung persönlicher Ziele benutzt – von der Industrie für den Umsatz, von der Politik für die Überwachung, von der Wissenschaft für Fördermittel und akademische Ehren.
Wir leben definitiv nicht in einer Zeit, die sich dadurch auszeichnet, dass sich persönliche Ziele der Wahrheit beugen, auch und gerade nicht in der Wissenschaft. Ein bisschen mehr Selbstkritik steht der Wissenschaft besser zu Gesicht, als die erörterten Anleihen aus der Verkaufspsychologie mit vorbereiteten Gesprächszielen, -rahmen und -techniken,
Mit skeptischen Grüssen
Korrektur
Ich habe Euren Podcast gerade erst entdeckt. Sorry für den späten Kommentar.
Als Skeptiker*in würde ich zunächst mal klarer trennen zwischen Evidenz (reproduzierbaren oder zumindest nachvollziehbar gemessenen Daten) und Simulationen, die hier im Gespräch wie auch anderswo als Ersatz für Evidenz gehandelt werden – eigentlich ein NoGo für Skeptizismus.
Ioannidis und andere Skeptiker haben das getan und die verfügbaren Daten nach bisher üblichen Kriterien überprüft. Ihnen das vorzuwerfen und das Bestreben, deduzierte Aussagen mittels manipulativer Techniken (Framing, vorbereitete Argumentationsketten etc.) als wissenschaftliche Wahrheit zu kommunizieren, halte ich für das Gegenteil einer erkenntnisoffenen (skeptischen) Geisteshaltung, die sich eigentlich nicht darum scheren sollte, das Gegenüber von irgendeinem Standpunkt zu überzeugen, ausser vom Zweifel selbst, erst recht nicht von Ängsten und mögen sie noch so existenziell sein.
Simulationen sind grundsätzlich eine megaspannende Sache. Die simulierten Szenarien beruhen jedoch auf teilweise fragwürdigsten Annahmen (Stichwort statischer R-Wert, Testspezifität, Massnahmeneffektivität), die von Wissenschaftlern geradezu zwingend in Zweifel gezogen werden müssen, umsomehr wenn man sich auf den Skeptizismus beruft.
Den Umgang mit den Ergebnissen solcher Simulationen halte ich deshalb für sehr altertümlich. „Experten“ rufen zu Einigkeit und Opferbereitschaft, damit die Götter (früher gross, heute klitzeklein) nicht zürnen. Und die „Nicht-Experten“ reagieren gewohnt abergläubisch „Wenn ich jetzt kein Opfer bringe, dann bleibt der Mond dieses Mal an der Sonne hängen und meine Ernte geht ein. Wenn mein Opfer aber richtig weh tut, dann scheint die Sonne auch künftig auf meinem Acker noch mehr.“
Dieses Verhalten ist wohl, wie auch im Altertum, politisch gar nicht mal so ungewollt und kann (und wird) von gewissen Playern zur Erreichung persönlicher Ziele benutzt – von der Industrie für den Umsatz, von der Politik für die Überwachung, von der Wissenschaft für Fördermittel und akademische Ehren.
Wir leben definitiv nicht in einer Zeit, die sich dadurch auszeichnet, dass sich persönliche Ziele der Wahrheit beugen, auch und gerade nicht in der Wissenschaft. Ein bisschen mehr Selbstkritik steht der Wissenschaft besser zu Gesicht, als die erörterten Anleihen aus der Verkaufspsychologie mit vorbereiteten Gesprächszielen, -rahmen und -techniken,
Mit skeptischen Grüssen